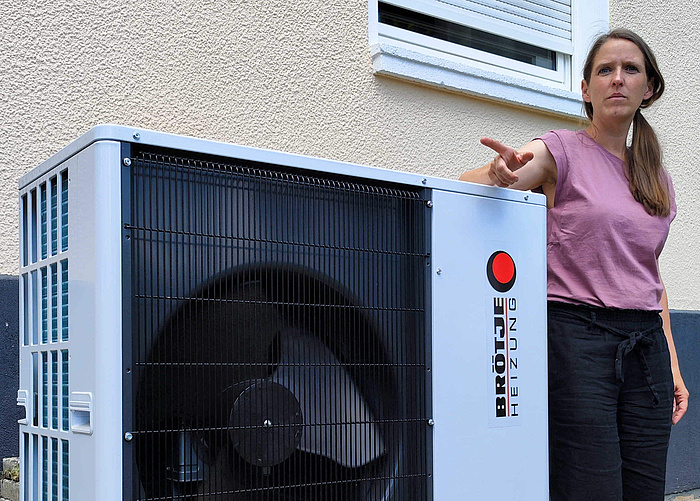So finden Sie das beste Wärmepumpen-Angebot
Letzte Aktualisierung: 09.07.2020
PV-Anlage: Bis zu 37% sparen!
Wir sparen für Sie bis zu 37% - durch unseren Experten-Vergleich!Jetzt Preise vergleichen!
Methoden zur Durchführung eines Thermal Response Tests
Was ist ein Thermal Response Test? Wie wird dieser durchgeführt? Was ist dabei zu beachten? Welche Methoden gibt es?
- Mit Hilfe eines Thermal Response Tests (TRT) bzw. Geothermal Response Tests (GRT) werden die thermischen Eigenschaften des Untergrunds hinsichtlich einer Erdwärme-Nutzung untersucht. Im Vordergrund stehen dabei die Abschätzung des langfristigen Entzugspotenzials, um die Auslegung von in der Regel Erdwärmesonden hinsichtlich einer zu erreichenden Heizwärmeleistung zu quantifizieren.
- Mit Hilfe eines TRT lassen sich Aussagen treffen über die Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds sowie die Wärmeübertragungseigenschaften der getesteten Erdwärmesonde. Die so gewonnenen Daten bilden die Grundlage für die Auslegung der Erdwärmesonden-Anlage, bzw. für die Wahl eines geeigneten Standorts zur Errichtung. Grundsätzlich lässt sich der TRT aber auch zum Aufspüren von Fehlern und zur Leistungskontrolle anwenden.
- Beim TRT-Messverfahren wird die Wärmeleitfähigkeit des Bodens mit einer Messapparatur an einer Erdwärmesonde gemessen. Dabei kann auch der thermische Bohrlochwiderstand bestimmt werden. Der TRT dient ausschließlich der Ermittlung von Daten zur Planung von Erdwärmesonden-Anlagen.
Inhaltsübersicht
Wärmepumpe im Rundum-Sorglos-Paket!
Lass Dir jetzt von unseren Experten in wenigen Minuten Dein ideales Wärmepumpen-Angebot zusammenstellen!Jetzt kostenloses Angebot anfordern!
Zielsetzung und Vorgehen beim Geothermal Response Test
Die genaue Kenntnis des Untergrunds und seiner thermischen Eigenschaften ist eine wichtige Voraussetzung für eine detaillierte Auslegung von Erdwärmesonden-Anlagen als Wärmequelle, Wärmesenke oder als Wärmespeicher. Während man bei Bohrungen für Einfamilienhäuser auf geologischen Erfahrungswerte aus dem Umkreis der geplanten Bohrung und „Faustformeln“ zur Dimensionierung zurückgreift, müssen bei größeren Erdwärmebohrungen genauere Untergrunddaten vorliegen, um einen langfristig sichern Betrieb zu gewährleisten.
Das gängige Messverfahren als Grundlage für die Auslegung einer Wärmequellenanlage stellt diesbezüglich der Thermal Response Test dar, der mittlerweile zu einem Standardverfahren (1) zur Berechnung der Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes geworden ist. Er wurde speziell für die bedarfsgerechte In-situ-Auslegung großer Erdwärmesondenanlagen entwickelt und kann unter bestimmten Voraussetzungen auch zur Abnahme, zur Betriebsüberwachung oder zur Fehlersuche eingesetzt werden. Der Thermal Response Test eignet sich auch für eine systemunabhängige Überprüfung von bereits fertig gestellten Erdwärmesonden.
Prinzipiell kann der „Thermal Response Test“ auf unterschiedliche Konstruktionen von Wärmeübertragern angewandt werden und ermöglicht eine Standortuntersuchung, bei der die effektive Wärmeleitfähigkeit des Gesteins über die gesamte Länge einer Sonde und der Bohrlochwiderstand, der Wärmedurchgangswiderstand vom Fluid an das Gestein, für die eingesetzte Sondenkonstruktion ermittelt werden.
Als Ergebnis des Thermal Response Test erhält man jedoch keine spezifischen Entzugsleistungen, sondern Werte der thermischen Eigenschaften des Untergrunds, die u. a. zur Bestimmung von Entzugsleistungen und Entzugsarbeiten bzw. Wärmeeintragsleistungen und -arbeiten benötigt werden.
| Fest- bzw. Lockergestein | Spezifische Wärmeentzugsleistung (1800 h/a) | Spezifische Wärmeentzugsleistung (2400 h/a) | Sondenlänge je 1 kW Heizleistung* (1800 h/a) | Sondenlänge je 1 kW Heizleistung* (2400 h/a) |
|---|---|---|---|---|
| Kies/ Sand, trocken | < 25 W/m | < 20 W/m | > 30 m | > 38 m |
| Kies/ Sand, wasserführend | 65 bis 80 W/m | 55 bis 65 W/m | 12 bis 9,4 m | 14 bis 12 m |
| Ton/ Schluff, feucht | 35 bis 50 W/m | 30 bis 40 W/m | 21 bis 15 m | 25 bis 19 m |
| Kalkstein (massiv) | 55 bis 70 W/m | 45 bis 60 W/m | 14 bis 11 m | 17 bis 13 m |
| Sandstein | 65 bis 80 W/m | 55 bis 65 W/m | 12 bis 9,4 m | 14 bis 12 m |
| Granit, Gneis | 65 bis 85 W/m | 55 bis 70 W/m | 12 bis 8,8 m | 14 bis 11 m |
| Basalt | 40 bis 65 W/m | 35 bis 55 W/m | 19 bis 12 m | 21 bis 14 m |
* βa = 4
Messung und Berechnung der Wärmeleitfähigkeit
Der Thermal Response Test wird an einer Erdwärmesonde durchgeführt, an die
- eine Umwälzpumpe und
- ein Heizelement sowie
- Sensoren zur Aufzeichnung der Vor- und Rücklauftemperatur
angeschlossen werden. Das Fluid, i.d.R. Wasser oder Sole, wird bis zum Erreichen der ungestörten Untergrundtemperatur im Kreis gepumpt. Danach wird das Heizelement zugeschaltet, um das Wasser zu erwärmen. Das so erwärmte Wasser strömt durch die Erdwärmesonde und kühlt sich dabei ab. Die Austrittstemperatur des Wassers aus der Sonde wird gemessen, das Wasser läuft wieder durch das Heizelement und der Kreislauf wiederholt sich. Über die Kurve des Temperaturanstiegs der Sonde kann über die Linienquellentheorie eine über die Gesamtsondenlänge gemittelte Wärmeleitfähigkeit des Untergrunds und der thermische Bohrlochwiderstand bestimmt werden.
Die ungestörte Bodentemperatur wird zu Beginn eines Thermal Response Test durch eine Zirkulation der Sole ohne gleichzeitige Erhitzung bestimmt. Da die gemessenen Temperaturen am Anfang der Zirkulation durch die noch nicht ausreichende Durchmischung der Sole beeinflusst sind, werden die Werte der ersten Minuten nicht als Richtwert für die ungestörte Bodentemperatur verwendet. Zudem kann bei längerem Betrieb der Zirkulationspumpe die Wärmeentwicklung der Pumpen das Ergebnis ebenfalls verfälschen. Je nach Länge der Sonde und der Pumpleistung liegt das Zeitfenster zur Bestimmung der ungestörten Bodentemperatur zwischen ca. 15 und 30 Minuten nach Einschalten der Zirkulationspumpe.
PV-Anlage & Wärmepumpe kombinieren!
Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Komplett-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!
Richtlinie VDI 4640 Blatt 5 beschreibt TRT-Messverfahren
Orientierung bei der Durchführung eines Thermal Response Test bietet die Richtlinie VDI 4640 Blatt 5 „Thermische Nutzung des Untergrunds; Thermal Response Test“ (2). Sie beschreibt ein Messverfahren zur Ermittlung von thermischen Eigenschaften des Untergrunds für Erdwärmesonden.
- Die Richtlinie VDI 4640 Blatt 5 beschreibt das TRT-Messverfahren zur Analyse der thermischen Eigenschaften eines Bodens in Vorbereitung der Errichtung einer Erdwärmesonden-Anlage.
- Die Richtlinie stellt den Aufbau von TRT-Geräten vor, und benennt die Anforderungen an Sensoren und die Messdatenerfassung. Sie leitet durch den konkreten Ablauf eines Thermal-Response-Tests.
- VDI 4640 Blatt 5 beinhaltet Informationen zur Auswertung der gesammelten Daten nach der Linienquellentheorie, und gibt Hinweise zu anderen verfügbaren Auswertungsverfahren. Es werden auch die Anforderungen an den Messbericht festgelegt.
Einsätze bei anderen Erdwärmetauschern, wie z.B. Energiepfähle, Erdwärmekollektoren etc., sind nicht Gegenstand der Richtlinie.
Weitere Methoden zur Durchführung von Thermal Response Tests
Neben dem herkömmlichen Thermal Response Test stehen weitere Methoden (3) zur Verfügung, mit denen man die Wärmeleitfähigkeiten und ungestörten Untergrundtemperaturen bestimmen kann. Jede dieser Test-Methoden bietet spezielle Vorteile in bestimmten Anwendungssituationen.
Thermal Response Test mit Temperaturprofilaufzeichnung
Eine über den Thermal Response Test hinausgehende zusätzliche Temperaturprofilaufzeichnung vor und jeweils in bestimmten Abständen nach einem herkömmlichen Thermal Response Test ermöglicht es, Bereiche zu zeigen, in denen eine höhere effektive Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes vorherrscht. Diese Bereiche kühlen nach dem Wärmeeintrag des Thermal Response Test schneller aus und lassen sich so qualitativ beschreiben. Vergleicht man diese Ergebnisse mit vorhandenen Bohrprofilen und Tabellenwerten für verschiedene Gesteinswärmeleitfähigkeiten, so kann man eine grobe tiefenaufgelöste Abschätzung der Untergrundwärmeleitfähigkeiten vornehmen. Die ungestörte Bodentemperatur kann man der vor dem Thermal Response Test durchgeführten Temperaturprofilmessung direkt entnehmen.
Diese Methode ist recht einfach mittels einer Temperaturmesssonde durchzuführen und benötigt zusätzlich lediglich das Bohrprofil der Erdwärmesonde und Tabellenwerte für Wärmeleitfähigkeiten (z.B. VDI 4640). Allerdings ist sie auch recht ungenau, da sie direkt von der Interpretation der Daten durch den durchführenden Geologen abhängt und kann damit tiefenaufgelöste Wärmeleitfähigkeiten nur qualitativ abbilden.
Alternativ bietet sich ein Thermal Response Test mit Temperaturprofilaufzeichnung mittels einer kabellosen NIMO-T-Messsonde an. Die so erhaltenen Temperaturwerte vor der Thermal Response Test-Messung und zu bestimmten Zeitpunkten in der thermischen Regenerationsphase, werden anschließend mittels numerischer Simulationen zurückgerechnet. Die Wärmeleitfähigkeiten der Umgebung werden hierbei solange angepasst, bis die so erhaltenen Temperaturen der modellierten Sole mit den gemessenen übereinstimmen. Auf diese Art und Weise sind sowohl tiefenaufgelöste Wärmeleitfähigkeiten als auch Hinweise auf Grundwasserfluss in einzelnen Tiefenlagen nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ bestimmbar.
Enhanced Thermal Response Test mit Glasfasermessung
Der enhanced Thermal Response Test (eTRT oder auch eGRT genannt) beruht auf der direkten, tiefenaufgelösten Temperaturmessung an Glasfaserkabeln während gleichzeitig eine gleichmäßige Erhitzung des Untergrundes stattfindet. Die so erhaltenen Messergebnisse können direkt zur tiefenaufgelösten Wärmeleitfähigkeitsberechnung herangezogen werden.
Ein enhanced Thermal Response Test zur Ermittlung tiefenaufgelöster Untergrundwärmeleitfähigkeiten wird mittels eines an der Wandung der Sondenrohre befestigten Glasfaser-Hybridkabels durchgeführt. Das Kabel besteht aus jeweils vier Glasfasern und vier Kupferlitzen. Die Glasfasern werden an ein faseroptisches Temperaturmessgerät angeschlossen, welches über Laserimpulse die Temperaturen entlang der Kabelstrecke bestimmen kann.
Der Testaufbau ist ähnlich zum herkömmlichen Thermal Response Test. Allerdings erfolgt die für einen Thermal Response Test erforderliche Wärmezuführung nicht über die Zirkulation erwärmter Sole in den Sonden, sondern über das Anlegen einer elektrischen Spannung an die vier Kupferlitzen des Kabels wodurch Wärme freigesetzt wird. Die eingebrachte Heizleistung ist so für jeden Punkt entlang des Kabels gleich hoch.
Die faseroptische Temperaturmessmethode bedient sich der Raman-Rückstreuung, die entsteht, wenn die Photonen eines Lasers mit den Elektronen des amorphen Quarzes der Glasfaser interagieren. Das rückgestreute Licht teilt sich in drei spektrale Bänder auf, das Rayleigh-Band sowie das Stokes- und das Anti-Stokes-Band. Das Anti-Stokes-Band ist direkt von der temperaturbedingten Gitterschwingung der Glasmoleküle abhängig. Da das Stokes-Band nahezu keine Temperaturabhängigkeit aufweist, kann so aus dem Verhältnis zwischen Stokes- und Anti-Stokes-Band unter Berücksichtigung weiterer Materialparameter die absolute Temperatur der Glasfaser an jedem Punkt der Messstrecke berechnet werden. Der räumliche Abstand eines gemessenen Punktes von der Lichtquelle wird über die gemessene Laufzeit zwischen dem Impuls und der Rückstreuung berechnet.
Erweiterter Thermal-Response-Test
Die Ausstattung einer Erdwärmesonde mit Glasfaserkabeln und ggf. Heizdrähten, machen enhanced Thermal Response Tests aufwendig und kostenintensiv. Der enhanced Thermal Response Test kommt deshalb vergleichsweise selten zur Anwendung.
Alternativ gibt es jedoch auch Möglichkeiten (4), einen durchgeführten Thermal-Response-Test in Kombination mit aufgenommenen Temperatur-Tiefenprofilen als enhanced Thermal Response Test auszuwerten und die effektive Wärmeleitfähigkeit des Untergrundes in nahezu jedem Tiefenabschnitt zu bestimmen. Hierbei können Wärmeleitfähigkeits-Tiefenprofile erstellt werden, die eine deutlich erhöhte Planungssicherheit und eine optimierte Nutzung der geothermischen Ressource ermöglichen.
Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!
Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!
Quellen:
(1) Innovative Verbesserungen bei Thermal Response Tests (J. Poppei, R. Schwarz, N. Mattson, G. Steinmann, L. Laloui)
(2) Richtlinie VDI 4640 Blatt 5 „Thermische Nutzung des Untergrunds; Thermal Response Test“ (VDI-Gesellschaft Energie und Umwelt (VDI-GEU))
(3) Bestimmung thermischer Untergrundparameter in Erdwärmesondenfeldern und Evaluierung tiefenaufgelöster Thermal Response Tests durch thermohydraulische Modellierungen (Dissertation von Florian Malm am Fachbereich Chemie, Pharmazie und Geowissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz)
(4) Auswertung des Thermal-Response-Tests (TRT) als Erweiterter Thermal-Response-Test (E-TRT) (GeoConsult Hamm)
Weitere Informationen über Erdwärmebohrungen
- Genehmigung von Erdwärmebohrungen
- Bohr- und Installationskosten
- Bemessung und Bohrung einer Erdwärmesonde
- Funktionsprinzip und Arten von Doppel-U-Sonden