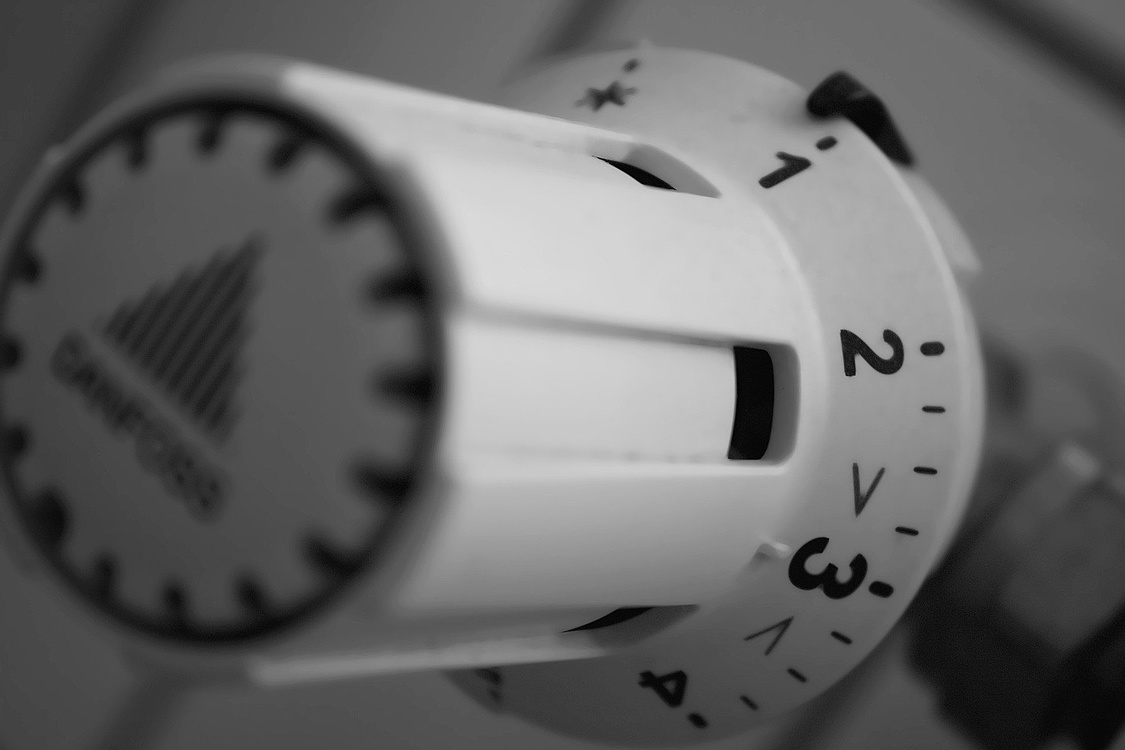Energiekrise: Bundesländer verkünden drastische Sparmaßnahmen
Anhand von Daten der EU-Kommission analysierte die Deutsche Presse Agentur, dass die Bundesrepublik von Anfang August bis März des kommenden Jahres rund 10 Milliarden Kubikmeter Gas einsparen muss, um die von den EU-Ländern beschlossenen Ziele zu erreichen. Diese Gasmenge entspricht in etwa dem jährlichen Durchschnittsverbrauch von fünf Millionen Vier-Personen-Haushalten.
Bei zu geringen Einsparungen und weitreichenden Versorgungsengpässen ist die EU befugt, einen Alarm mit verbindlichen Einsparzielen auszulösen.
Aus der Sicht der Bundesnetzagentur müssten die Menschen in Deutschland allerdings nicht nur 15 %, sondern 20 % Energie einsparen, um einen Gasmangel im Winter zu verhindern. Anderenfalls drohen bereits im Dezember eine Gasmangellage sowie zu niedrige Speicherfüllstände am Ende der kommenden Heizperiode.
Der Appel zum Sparen richtet sich jedoch nicht nur an die privaten Haushalte, sondern auch an die Bundesländer, die ihrerseits Regelkataloge für öffentliche Gebäude, Straßenbeleuchtung oder auch Arbeitsstätten entwerfen (sollten). Während Städte wie Hamburg oder Berlin ihre Leitlinien bereits veröffentlicht haben, hängen andere Städte und Regionen noch hinterher.
Die Temperaturregulierung ist unvermeidbar
Baden-Württemberg, Bayern und Bremen wollen die Temperaturen in den Büros der Landesverwaltungen auf das gesetzliche Minimum, also 18° C, absenken. NRW setzt in seinen städtischen Büros auf maximal 19° C und Halle auf 20° C während der Heizperiode.
In Berlin, Hamburg, Duisburg und dem hessischen Bad Doberan und Güstrow dagegen strebt man die Mindesttemperatur nach „Arbeitsstättenrichtlinie für Arbeitsräume mit vorwiegend sitzender Tätigkeit“ – gegenwertig 20° C – an. In Treppenhäusern und Fluren dürfen jedoch 16° C nicht überschritten werden. In Niedersachsen werden mit einer Spanne von 10° C bis 15° C auch die Raumtemperaturen von Technik- und Lagerräumen begrenzt.
Im rheinland-pfälzischen Kaiserslautern beginnt der Heizbetrieb in städtischen Liegenschaften in diesem Jahr erst am 01. Oktober, statt wie gewohnt am 01. September. Allein durch diese Maßnahme lassen sich bis zu 1 Million kWh Heizenergie einsparen. In den Schulen kühlt es hier auf 17° C, in Nebenräumen auf 16° C und in Sport- und Mehrzweckhallen auf 15° C ab. Kitas bleiben von der Regulierung ausgenommen. Zusammengerechnet beläuft sich die Ersparnis auf rund 3.670.000 kWh.
Im schleswig-holsteinischen Neumünster prüft man zusätzlich, ob durch eine Reduzierung der Gleitzeit Energie gespart werden kann.
Das Händewaschen in städtischen Gebäuden oder am Arbeitsplatz hat im kommenden Winter vielerorts leider keinen wärmenden Effekt. Baden-Württemberg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und NRW schalten das Warmwasser in den Sanitärbereichen vollständig ab.
PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!
Konfiguriere jetzt online Deine eigene Solar-Anlage + erhalte in wenigen Minuten die besten Experten-Angebote aus Deiner Region!PV-Anlage online planen und kostenlos Angebote erhalten
Im Gegenzug: Verzicht auf angenehme Kühlung im Sommer
Die Regulierung der Temperaturen betrifft vielerorts auch die Klimaanlagen. In Baden-Württemberg beispielsweise werden sie – außer an extremen Hitzetagen – vollständig abgeschaltet.
Um Kühlung zu sparen, sollen Büroräume in Hamburg im Sommer morgens und abends gelüftet und zugleich verschattet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Eine Kühlung durch Klimageräte auf weniger als 26° C ist in Büroräumen untersagt.
In Niedersachsen werden Klimaanlagen gänzlich verboten. Im Bereich der Raumlüftung will Bremen die entsprechenden Anlagen in öffentlichen Gebäuden auf ein Mindestmaß reduzieren. In Hamburg soll das Stoßlüften zur Regel werden, um Luftreinigungsgeräte in gut belüftbaren Räumen abschalten zu können.
NRW möchte Lüftungsanlagen entweder komplett entfernen oder durch effizientere Geräte ersetzen.
Das BMWK geht diesbezüglich mit gutem Beispiel voran: U.a. wird der Pressekonferenzsaal des Bundeswirtschaftsministeriums seit diesem Sommer nicht mehr klimatisiert.
Ergänzende Maßnahmen am Arbeitsplatz
Möglicherweise kommt das Home-Office zurück – zumindest erwägen einige der Bundesländer diese Option, darunter Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen.
Darüber hinaus sollen energieintensive Dienstreisen, wie in Zeiten des Lockdowns, durch Videokonferenzen ersetzt werden. Auf letztere Strategie setzen u.a. Bayern und Hamburg.
In einigen Teilen des Landes können zusätzliche Maßnahmen wie die Reduktion von Kopiergeräten und Druckern, eingeschränkter Betrieb von Aufzügen und Desk-Sharing hinzukommen.
Gehen den Ländern jetzt die Lichter aus?
Nein, so dramatisch ist es nicht. Die Beleuchtung im öffentlichen Raum wird lediglich dort reduziert, wo sie die Menschen nicht in ihrem Alltag einschränkt. Für eine Weile muss jedoch auf das nächtliche Anstrahlen vieler bedeutsamer Gebäude verzichtet werden. Dazu zählen die Berliner Siegessäule, der Warnemünder Leuchtturm, der Kölner Dom und das Schloss in Wernigerode.
In Innenräumen wollen nun nahezu alle Bundesländer auf LED-Leuchten setzen, und zwar nicht nur in Bürogebäuden, sondern teils auch in Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Die Städte Bonn und Neumünster möchten sämtliche Leuchtstoffröhren stadtweit durch LED-Technik austauschen.
Wo noch nicht geschehen, sollen nun auch Ampeln und Straßenlaternen moderne LED-Beleuchtung erhalten. Durch neue LED’s ließen sich, je nach Lampentyp, zwischen 20 und 75 % Energie einsparen.
Im brandenburgischen Cottbus hat man nach Angaben der Stadtverwaltung bereits in den vergangenen Jahren viele Sparmaßnahmen eingeleitet, zu denen auch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zählt.
Bremen möchte mit der Umstellung auf LED-Laternen den jährlichen Stromverbrauch um bis zu 5 Millionen kWh reduzieren. In den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen sollen, nach Rücksprache mit der Polizei, einzelne Ampeln über Nacht abgeschaltet werden.
Die Schwimmbäder trifft es offenbar besonders hart
Den richtigen Wasserratten dürfte es kaum auffallen, den Badegästen, die schnell frieren, wohl schon eher. In sämtlichen Bädern Deutschland sinken die Wassertemperaturen. Letztere dürfen in Duisburg und Berlin die Marke von 26° C nicht länger überschreiten, der Grenzwert in Hamburg liegt bei 25° C.
Auch in Potsdam wird das Wasser um 2° C kühler, zugleich erfolgt eine leichte Senkung der Temperatur in den Saunas.
Im niedersächsischen Landkreis Peine wird mit einer Reduktion von 1,5° C bis 2° C bis zu 10 % Energie eingespart.
Das Warmfreibad in Kaiserslautern wird für den Rest der Saison als Kaltbad betrieben, also ohne Erwärmung des Becken- und Duschwassers. Daraus ergibt sich eine Einsparung von Heizenergie in Höhe von 760.000 kWh.

Aus den städtischen Brunnen sprudelt kein Wasser mehr
Bayern schaltet die Pumpen der Brunnen, in denen keine Tiere leben, ab. Auch in Bonn endet der Betrieb von Brunnen und Wasserspielen mit dem Ende der aktuellen Hitzeperiode.
Die öffentlichen Brunnenanlagen in Hamburg verabschieden sich am 15. September 2022. Das betrifft unter anderem den Brunnen am Platz der Republik in Altona und den Brunnen im Innenhof des Hamburger Rathauses.
Auch die berühmte Alsterfontäne der Hansestadt sprudelt dann nicht mehr. Die Wasserlichtorgel in Planten un Blomen beendet frühzeitig ihre Saison.
Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!
Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!
Auf kurzfristige folgen mittelfristige Maßnahmen
Nicht alle energiesparenden Maßnahmen können unmittelbar umgesetzt werden. Doch viele Bundesländer haben auch mittelfristige Ziele in ihre Planung mitaufgenommen. Hessen plant den Austausch von Heizungssystem und Fenstern und möchte zusätzlich auf bessere Dämmstandards von Gebäuden achten.
Auch die niedersächsische Stadt Braunschweig erkennt das Einsparpotenzial durch nachträgliche Dämmung an Fassaden, Fenstern und Dächern. Hannover plant, der energetischen Sanierung von Bestandsbauten Vorrang vor großen Neubauprojekten zu gewähren.
Die Hansestadt Hamburg strebt den Ausbau der Fernwärmeversorgung, die verstärkte Nutzung regenerativer Energien, mehr Fassaden- und Dachbegrünungen für Kühlungszwecke sowie zusätzliche Ladesäulen für Kraftfahrzeuge an.
Jeder noch so schöne Plan muss am Ende auch funktionieren
Es überrascht, wie schnell ein bürokratisches Deutschland Maßnahmen zur Energieeinsparung verabschieden kann – häufig aber eben nur dann, wenn es angesichts der Dramatik von Gas- und Strompreisen sowie drohenden Versorgungsengpässen nicht mehr anders geht.
Viele Städte und Gemeinden konnten ihr Regelkonzept bereits veröffentlichen und haben dabei auch an ein notwendiges Monitoring gedacht. Denn solche tiefgreifenden Maßnahmen müssen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit kontinuierlich überprüft werden.
Der Oberbürgermeister von Saarbrücken schlägt, zur Sicherung des verbindlichen Maßnahmenkataloges, eine landesweite Task Force zur Energiesicherheit unter Führung der Landesregierung vor. Hamburg konzipiert eine Energiedatenbank für alle FHH-Gebäude, etwa auf Basis von bestehenden Systemen städtischer Energiegesellschaften.
Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kündigte gemeinsam mit dem hessischen Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) ein Monitoring des Sofortprogramms an, um gegebenenfalls nachjustieren zu können.
Für Städte ohne Energiemanagement wird die Zeit jetzt knapp
Da der genaue Umfang von Preissteigerungen völlig unklar ist und die Kosten die kommunalen Haushalte massiv unter Druck setzen werden, sollten sich jene, die mit ihren Plänen hinterherhängen, dringend beeilen.
Die Stadt Frankfurt (Oder) denkt zwar über Energiesparmaßnahmen nach, hat nach Angaben von Stadtsprecher Uwe Meier jedoch noch keine konkreten Schritte unternommen.
Magdeburg erarbeitete nach eigenen Angaben bereits im Jahr 2005 ein Energiemanagement für öffentliche Einrichtungen und Gebäude. In Weißenfels und Köthen (ebenfalls Sachsen-Anhalt) sind zurzeit überhaupt noch keine Sparmaßnahmen geplant.
Im benachbarten Sachsen stellen zwar einige Kommunen die notwendigen Konzepte auf, doch auf Landesebene bleibt es still. Heftige Kritik gibt es hierfür vom sächsischen Bund für Umwelt und Naturschutz: Höchste Zeit, dass sich etwas ändert!
Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?
Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!