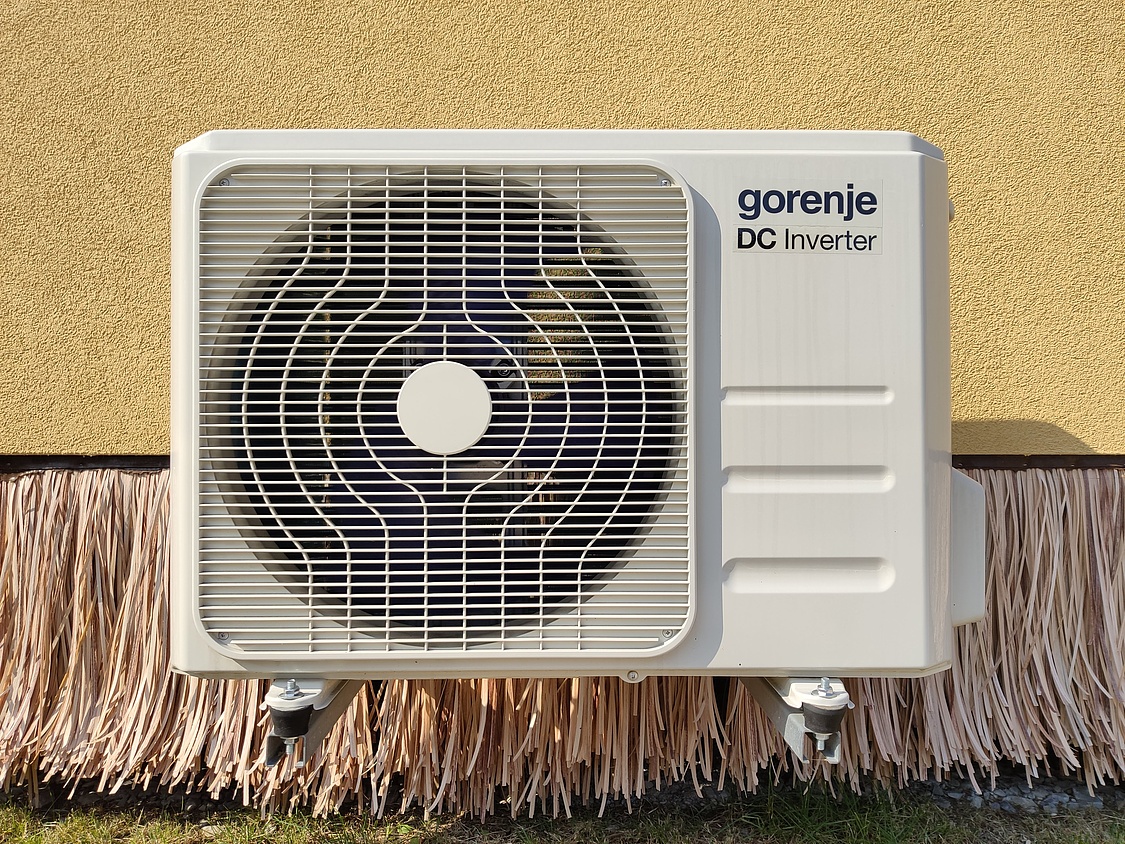Stoppt die neue Kältemittel-Vorschrift unseren Wärmepumpen-Ausbau?
Fluorierte Treibhausgase („F-Gase“) haben ein Erderwärmungspotenzial, das um ein Vielfaches höher ist als das von Kohlendioxid. Auf teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW) entfallen rund 90 % der F-Gas-Emissionen. Sie werden hauptsächlich als Kältemittel in Kühl- und Gefrierschränken, Klimaanlagen und Wärmepumpen verwendet, daneben aber auch als Treibmittel in Asthmasprays und technischen Aerosolspraydosen, in Feuerlöschern sowie als Treibmittel für Schäume. Um den Klimawandel einzudämmen und Gesundheit und Wohlergehen der Menschen in der EU zu schützen, müssen diese Emissionen daher gesenkt werden.
EU-Vorschläge zur strengeren Kontrolle von F-Gasen
Am 5. April 2022 hat die Europäische Kommission einen Legislativvorschlag zur Aktualisierung der F-Gase-Verordnung vorgelegt. Hauptziel der Vorschläge zu F-Gasen und ODS ist es, die Emissionen dieser starken Treibhausgase weiter zu verringern. Durch den verschärften F-Gas-Vorschlag solle über die nach den geltenden Rechtvorschriften der F-Gase-Verordnung erwartete Verringerung hinaus bis 2030 das Äquivalent von 40 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart und bis 2050 insgesamt eine zusätzliche Einsparung des Äquivalents von 310 Millionen Tonnen CO2erreicht werden.
- Mit dem Vorschlag würde das Quotensystem für teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (Ausstieg aus der Verwendung von HFKW) verschärft, wodurch die potenziellen Klimaauswirkungen neuer HFKW, die auf den EU-Markt gelangen, zwischen 2015 und 2050 um 98 % verringert würden. Außerdem werden neue Beschränkungen eingeführt, um sicherzustellen, dass F-Gase nur dann in neuen Einrichtungen verwendet würden, wenn keine geeigneten Alternativen zur Verfügung stehen. So wird beispielsweise bis 2031 die Verwendung von SF6, dem stärksten Treibhausgas, in allen neuen elektrischen Übertragungseinrichtungen („Schaltanlagen“) schrittweise verboten werden.
- Der Vorschlag würde es den Zoll- und Überwachungsbehörden erleichtern, Ein- und Ausfuhren zu kontrollieren und gegen den Handel mit illegalen F-Gasen und Einrichtungen vorzugehen. Darüber hinaus werden die Sanktionen verschärft und stärker standardisiert werden. Das Quotensystem wird durch strengere Registrierungsvorschriften und die Einführung eines festen Quotenpreises auf echte Gashändler beschränkt werden. Die Zahl der Ingenieure in Europa, die für den Umgang mit klimafreundlichen Einrichtungen qualifiziert sind, würde zunehmen, da die Mitgliedstaaten ihre Zertifizierungs- und Ausbildungsprogramme auf klimafreundliche Technologien, die F-Gase ersetzen oder deren Verwendung reduzieren, ausweiten müssten.
- Ein breiteres Spektrum von Stoffen und Tätigkeiten würde abgedeckt, und die Verfahren für die Meldung und Überprüfung von Daten würden verbessert.
- Mit dem F-Gas-Vorschlag würden bestimmte Ausnahmen abgeschafft und der Ausstieg der EU aus der Verwendung von HFKW vollständig mit dem Montrealer Protokoll in Einklang gebracht.
PV-Anlage im Rundum-Sorglos-Paket!
Konfiguriere jetzt online Deine eigene Solar-Anlage + erhalte in wenigen Minuten die besten Experten-Angebote aus Deiner Region!PV-Anlage online planen und kostenlos Angebote erhalten
HFKW-Phase-Down könnte Einführung von Wärmepumpen gefährden
Im Rahmen der Verbändeanhörung haben die Branchenverbände BTGA - Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e. V., FGK - Fachverband Gebäude-Klima e. V. und RLT-Herstellerverband - Herstellerverband Raumlufttechnische Geräte e. V. eine gemeinsame Stellungnahme zum Vorschlag der EU-Kommission zur Neufassung der F-Gase-Verordnung an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz übermittelt und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zur Kenntnis gegeben.
In der Stellungnahme begrüßen die drei Verbände viele Aspekte des Vorschlags der EU-Kommission, die die Anforderungen an Dichtheitsprüfungen, Eindämmung, Berichterstattungen, Zertifizierung und Schulung erweitern werden.
Sie weisen aber auch darauf hin, dass der Vorschlag eines ehrgeizigeren HFKW-Phase-Down – eine stufenweise Reduzierung teilfluorierter Kohlenwasserstoffe de facto zu einem Ausstieg aus diesen Kältemitteln bis 2027 führen würde. Auf HFKW als Kältemittel sind jedoch auch Wärmepumpen angewiesen. Ein Ausstieg bis zum Jahr 2027 würde die beschleunigte und umfassende Einführung von Wärmepumpen in den kommenden Jahren ernsthaft gefährden - die Klimaschutz- und Energieeinsparziele für 2030 würden in weite Ferne rücken, warnen die Verbände.
BTGA, FGK und RLT-Herstellerverband fordern deshalb, die aktuelle Regelung zur Reduzierung bis mindestens 2030 beizubehalten. Sie stellt sicher, dass genügend Kältemittel zur Verfügung stehen, um die erforderliche Marktdurchdringung der Wärmepumpen und damit die Klimaschutzziele im Gebäudebereich erreichen zu können. Außerdem soll nach Auffassung der Verbände nicht allein das Kältemittel in den Fokus gestellt werden, sondern die Gesamtenergieeffizienz der Anlage. Dieser so genannte TEWI-Faktor - TEWI bedeutet Total Equivalent Warming Impact - berücksichtigt nicht nur den direkten Einfluss des Treibhausgases im unwahrscheinlichen Fall des Austritts, sondern auch die Emissionen im Lebenszyklus der Anlage.
Heizkosten sparen & Umwelt schonen?!
Unsere Experten erstellen Dir in wenigen Minuten ein Wärmepumpen-Angebot nach Deinen Wünschen. Digital & kostenlos.Jetzt kostenloses Angebot anfordern!
HFKW sind kein nachhaltiger Ersatz für FCKW
In den 1950er Jahren wurden Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) als großer Fortschritt gefeiert. Mit ihrer Ungiftigkeit und Nichtentflammbarkeit galten sie als perfekte Alternative zu älteren Kältemitteln, wie Schwefeldioxid und Ammoniak. In den 1970er Jahren wuchs das Verständnis für Umweltfragen und es wurde erkannt, dass FCKW wesentlich zum Abbau der Ozonschicht beiträgt. Dies führte zum Montrealer Protokoll, durch das FCKW und HFCKW kontrolliert und schließlich in den 1990er Jahren aus dem Verkehr gezogen wurden.
Als Ersatz für FCKW und HFCKW wurde eine weitere Familie von Fluorkohlenwasserstoffen entwickelt: die teilhalogenierten Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW). Sie sind ungiftig und nicht brennbar und besitzen kein Ozonabbaupotenzial. Diese Produkte sind heute in der Kühlindustrie und u.a. bei der Herstellung von Wärmepumpen weit verbreitet.
Durch den zunehmenden Fokus auf den Klimawandel und die Treibhausgasemissionen wurde jedoch deutlich, dass HFKW starke Treibhausgase mit einem hohen Treibhauspotenzial (GWP = Global Warming Potential) sind. Daher wurden weitere Vorschriften erlassen, um die Verwendung dieser Produkte schrittweise einzustellen.
Die F-Gase Verordnung in Europa etwa setzt auf Reduktion und Verbote. Durch die gesetzlich vorgeschriebene Reduktion der handelbaren Menge, kommt es zu einer Preiserhöhung, was diese Stoffe für Betreiber unattraktiver macht. Der zweite Aspekt der F-Gase-Verordnung sind Verwendungsverbote, die darauf abzielen, die Verwendung von Produkten mit hohem GWP-Wert schnell zu unterbinden und den Gesamt-GWP-Wert von Kältemitteln bzw. deren Inverkehrbringung in der EU im Laufe der Zeit zu senken. Während die F-Gase-Verordnung nur in Europa gilt, hat sich der Rest der Welt auf das Kigali-Abkommen geeinigt. Es spiegelt im Grunde die F-Gase-Verordnung wider, indem es einen weltweiten Ausstieg und Verwendungsverbote vorsieht.
Auch die AVV Klima (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen) der deutschen Bundesregierung, die Anfang 2022 in Kraft getreten ist, zielt in dieselbe Richtung. Sie enthält eine „Negativliste“ von Leistungen, die von Dienststellen des Bundes nicht mehr bezogen werden dürfen. Dazu gehören Baustoffe, die teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW) und teilhalogenierte Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW) enthalten oder unter Verwendung dieser Stoffe hergestellt wurden. Auch Flüssigkeitskühler mit mehr als 10 Kilowatt Nennkälteleistung dürfen hiernach keine Kältemittel mit GWP ≥ 150 beinhalten.
Durch ihre Umweltschädlichkeit und die Regulierung bieten FKW-Kältemittel de facto keine Zukunftssicherheit. Die von der Kälteindustrie propagierten HFO-Kältemittel stellen auch keine realistische Alternative dar. Vor ihnen warnt die Wissenschaft bereits, weil sie in der Natur zu persistenter Trifluoressigsäure (TFA) abgebaut werden, die sich in Oberflächengewässern, im Grundwasser und in den Meeren anreichert. TFA ist bereits in verdünnter Form schädlich für Wasserorganismen und steht in Verdacht, auch das menschliche Zentralnervensystem zu beeinflussen. Darüber hinaus wird Flussspat bzw. Calciumfluorid, welches den wesentlichen Ausgangsstoff der gesamten Fluorchemie darstellt, auf der EU-Liste der 30 kritischsten Rohstoffe geführt, da weltweit nur wenige große Lagerstätten in China und Mexiko existieren.
Fördermittel-Beantragung oder Sanierungsfahrplan?
Unsere geprüften Energieeffizienz-Experten übernehmen Ihren Förderantrag & erstellen in wenigen Tagen Ihren Sanierungsfahrplan - zum Sparpreis!Jetzt Angebot anfordern!
Fokus muss zukünftig auf natürlichem Propan als Kältemittel liegen
Daher rücken nunmehr die sogenannten naturidenten Kältemittel ins Zentrum der Aufmerksamkeit, darunter vor allem Propan (R-290). Propan ist eine natürlich vorkommende Substanz, die als Nebenprodukt bei der Erdgasförderung und der Ölraffination anfällt. Es wird in verschiedenen Bereichen erfolgreich genutzt, z. B. zum Kochen, als Brennstoff für Motoren, zum Löten und Schweißen oder als Treibstoff für Heißluftballons. Und eben als Kältemittel in Wärmepumpen.
Propan gehört zu den Kohlenwasserstoffen und ist grundsätzlich seit über 100 Jahren als Kältemittel bekannt, konnte aber in der Vergangenheit nicht eingesetzt werden. Das lag vor allem daran, dass durch seine Entflammbarkeit entscheidende Komponenten in den eingesetzten Kältemaschinen nicht für den Einsatz von Propan geeignet waren, etwa der Kompressor oder Teile der Elektronik, und gesetzliche Vorgaben die Nutzung untersagten. Die technologische Entwicklung sowie Gesetzesänderungen in Europa machen den Einsatz von Propan jetzt möglich, obwohl es hoch-entzündlich ist. Moderne Lösungen ermöglichen die Nutzung von Propan mit geringstmöglichen Füllmengen, wodurch das Risiko auf ein niedriges Niveau sinkt. Mit den entsprechenden technologischen und organisatorischen Maßnahmen ist Propan als Kältemittel sicher beherrschbar.
Propan hat einen vernachlässigbaren GWP-Wert von 3, ist ungiftig und besitzt kein Ozonabbaupotential. Aufgrund dessen unterliegt es keinerlei Beschränkungen und kann als langfristige Lösung angesehen werden. Grundsätzliche Voraussetzung sind Maßnahmen zur Risikovermeidung bei der Verwendung entflammbarer Kältemittel. Dazu gehören eine sorgfältige Auslegung der Systeme und die Anwendung von Sicherheitsnormen. Werden diese Aspekte berücksichtigt, bietet Propan, neben seiner Unbedenklichkeit in Bezug auf die Umweltbelastung, eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen:
Denn neben einem niedrigen Preis und einer seiner Verfügbarkeit, besitzt Propan hervorragende thermodynamische Eigenschaften, die zu einer hohen Energieeffizienz z. B. beim Einsatz in Propan-Wärmepumpen führen. Beispielsweise ist die latente Verdampfungswärme von Propan fast doppelt so hoch wie die der gebräuchlichsten HFKW-Kältemittel. Dies bedeutet einen höheren Kühl-/Wärmeeffekt bei gleichem Kältemittelmassenstrom. Es versteht sich von selbst, dass eine höhere Effizienz niedrigere Betriebskosten und weniger indirekte CO2-Emissionen bedeutet.